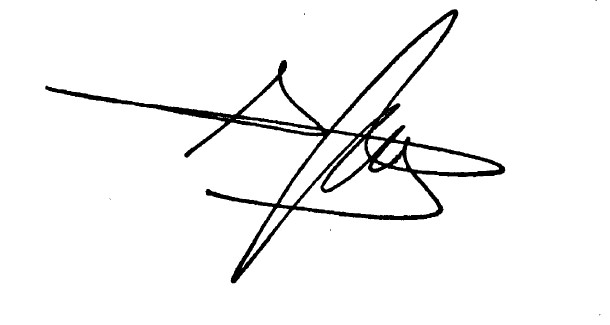Reflexionen der Präsidenten des Europäischen Parlaments: Josep Borrell Fontelles
Das Amt des Präsidenten des Europäischen Parlaments (EP) ist eine privilegierte Stellung. Sie verschafft Einblick in das Geschehen in der Europäischen Union und in alle Angelegenheiten der globalisierten Welt, die sich sämtlich in der Tätigkeit des EP widerspiegeln.
Diese 30 Monate waren voller bewegender Momente – die EU-Erweiterung, die Ablehnung des Verfassungsvertrags und die Suche nach Lösungsalternativen, die Beziehungen zu unseren näheren und entfernteren Nachbarn und die neuen Probleme mit der Einwanderung, der Energiefrage und dem Terrorismus. Daher war meine Tätigkeit als EP-Präsident die aufregendste Erfahrung meines politischen Lebens, und es ist nicht einfach, darüber Bilanz zu ziehen.
Das Europäische Parlament ist die einzige EU-Institution, die von den Bürgern direkt gewählt wird und ist deshalb der Inbegriff des demokratischen Prinzips in der institutionellen Struktur der EU. Es verfügt zwar noch nicht über alle klassischen Vollmachten parlamentarischer Versammlungen, etwa zur Verabschiedung von Steuern, übt jedoch wichtige Gesetzgebungs-, Haushalts- und Kontrollfunktionen aus. Dazu bedient es sich einer stark konsensgeprägten politischen Dynamik, die sich grundsätzlich vom Vorgehen der nationalen Parlamente unterscheidet, in denen ein vom Wesen her konfliktgetragenes Verhältnis zwischen Regierung und Opposition vorherrscht.
Im Unterschied zum Rat, in dem die nationalen Interessen der Mitgliedstaaten vertreten werden und sich gegenüberstehen, steht das EP für die gemeinsamen Interessen der Bürger der Europäischen Union, ist seine Aufgabe die Suche nach einem Konsens für die gemeinschaftlichen Politikbereiche. Ich glaube wirklich, dass diese Aufgaben im Laufe der sechsten Wahlperiode, in der das EP politisch gereift ist, an Kraft gewonnen haben.
Die Erweiterung war eine sehr wichtige Besonderheit meiner Präsidentschaft. Am 20. Juli 2004 stand ich an der Spitze eines Parlaments mit 732 Abgeordneten aus 25 Ländern, die 163 politische Parteien vertraten und sich in zwanzig offiziellen Sprachen äußerten. Am 1. Januar 2007 waren es dann mit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens 785 Abgeordnete, und zusammen mit dem Gälischen wird die sprachliche Vielfalt nunmehr von 23 Sprachen geprägt.
 Gruppenfoto der neuen bulgarischen und rumänischen Beobachter © Europäische Union 2005 – Europäisches Parlament
Gruppenfoto der neuen bulgarischen und rumänischen Beobachter © Europäische Union 2005 – Europäisches Parlament
Darüber hinaus waren zu diesem Zeitpunkt 60 % der Abgeordneten neu im EP; 168 von ihnen kamen aus den 10 neuen Mitgliedstaaten. Ich war selbst ein „Neuling“ und mich erfasste ein gewisses Schwindelgefühl in Anbetracht der Größenordnung der Veränderungen und der Komplexität der Aufgaben einer Institution, die nun ganz anders geartete politische Erfahrungen aufnehmen musste. Doch das erweiterte EP bestand diese Probe glänzend und übte seine Tätigkeit mit überraschender Normalität aus, was der Arbeit der Dienste und der Mitarbeiter, insbesondere aber des ehemaligen Generalsekretärs Julian Priestley, des wahren Urhebers dieses Erfolgs, zu verdanken war.
Neben dieser großen strukturellen Veränderung erlebten wir konkrete Momente von besonderer Bedeutung. Zu diesen zählte – vielleicht als einer der wichtigsten, zumindest wenn es nach dem Medieninteresse geht – der Prozess der Amtseinführung der Kommission Barroso im Wege der Anhörungen („Hearings“) der designierten Kommissare, die in der Rücknahme eines Vorschlags kulminierten, weil als sicher galt, dass dieser vom EP abgelehnt würde.
In diesem Prozess festigte das EP seine politische Stellung und war nicht mehr der „Papiertiger", als der es von vielen bezeichnet worden war. Es wagte, von den Befugnissen, die ihm in den Verträgen zuerkannt worden waren, Gebrauch zu machen, ohne dadurch auch nur einmal eine Funktionskrise der EU heraufzubeschwören. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Anhörung der Kommissare nicht um eine bloße Formsache und beugten sich die Abgeordneten nicht einfach nur den Anweisungen der Regierungen der Mitgliedstaaten, wie viele angenommen hatten. Seit der Ablehnung des ersten Vorschlags für die Kommission Barroso, bei der in Wirklichkeit nur eines der vorgeschlagenen Mitglieder beanstandet wurde, gilt das Parlament nicht mehr als Ort des „Tohuwabohus“ oder als unnützer „Talking Shop“.
Schon damals pflegte ich zu sagen: Einer aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Institution kann man nicht Befugnisse unter der Voraussetzung übertragen, dass diese nicht wahrgenommen werden. Das EP hat von seinen Rechten im Rahmen der demokratischen Normalität Gebrauch gemacht, und mit dem auf diese Weise gewonnenen Einfluss hat sich seine Rolle innerhalb des institutionellen Dreigespanns der Union gefestigt.
Diesem polemischen Moment muss ich die Erinnerung an zwei weitere Augenblicke hinzufügen, von denen einer ganz besonders feierlich und positiv war, der andere dagegen zutiefst traurig.
Der erste war die Unterzeichnung des Verfassungsvertrages im glanzvollen Saal der Horatier und Curiatier auf dem Römischen Kapitol. Dort nutzte ich im Namen des Parlaments die Gelegenheit, die anwesenden Staats- und Regierungschefs an den im Zuge der Entwicklung der EU zurückgelegten Weg von Rom nach Rom zu erinnern. Da wir damals nicht wussten, dass der Vertragstext bei den Referenden in Frankreich und in den Niederlanden Schiffbruch erleiden würde, war das für den damaligen Augenblick der Höhepunkt der europäischen politischen Bestrebungen, die heute leider etwas abgeschwächt sind.
Der zweite Augenblick war der, an dem ich den in der Plenarsitzung anwesenden Abgeordneten im Juli 2005 das tragische Ausmaß der terroristischen Attentate in London bekannt geben musste, die für mich stark die Erinnerung an die Anschläge in Madrid wachriefen.
Es gab andere Momente von politischer Bedeutung, die ich hier nicht alle nennen kann. Dazu gehörte die Szene auf dem EU-Russland-Gipfel in Lahti, Finnland, als ich dem neben mir sitzenden Präsidenten Putin sagen musste, dass Europa die Menschenrechte für die Energieversorgung nicht aufgeben darf. Oder meine nur wenige Stunden zeitversetzten Ansprachen vor der Knesset in Jerusalem und der Palästinensischen Nationalversammlung in Ramallah. Oder als ich in Kairo der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer vorstand und wir von dieser Stelle aus wichtige Vermittlungsarbeit im Konflikt um die dänischen Mohammed-Karikaturen leisteten. Oder als dann schon am Ende meiner Amtszeit die Parlamentarische Versammlung Eurolat gegründet wurde, die uns mit Lateinamerika verbindet. Ich habe mich sehr für dieses Projekt eingesetzt, das ich im Wettlauf gegen die Zeit vor dem Hintergrund nicht weniger Bedenken voranbrachte. Als kurzzeitiger Kopräsident spürte ich die Befriedigung, eine höhere Aufmerksamkeit des EP für Lateinamerika erreicht zu haben.
 Plenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum (Euromed). Abgebildet (von links nach rechts): Dietmar Nickel, Josep Borrell Fontelles, Fouad Mebazaa © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament
Plenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum (Euromed). Abgebildet (von links nach rechts): Dietmar Nickel, Josep Borrell Fontelles, Fouad Mebazaa © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament
Ich konnte auch feststellen, welch wichtige Rolle Europa dank seiner internationalen Kooperationsprojekte vom Nigerbogen bis in die kolumbianischen Berge und auch dank seiner militärischen Präsenz im Interesse der Friedenserhaltung spielt, beispielsweise im Libanon, wohin ich mich unmittelbar nach den Bombenangriffen vom Sommer 2006 begab, um den Premierminister ins EP einzuladen.
In der Welt herrscht ein reges Interesse an Europa. Das EP hat versucht, sich ihm zu stellen, um das zu stärken, was man unter dem Begriff parlamentarische Diplomatie kennt. Zum Beispiel wurden Wahlbeobachter in 26 Länder entsandt, von denen besonders die Ukraine, Palästina, Afghanistan, der Kongo und Venezuela zu nennen sind. Es hat sich für die Welt zu einem wichtigen öffentlichen Forum entwickelt, wo 15 Staatschefs aus Nichtmitgliedstaaten der EU gesprochen haben, unter ihnen Evo Morales und Mahmud Abbas.
 EP-Präsident Josep Borrell Fontelles (rechts) trifft den Präsidenten der Palästinensischen Behörde Mahmud Abbas (links) in Straßburg © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament
EP-Präsident Josep Borrell Fontelles (rechts) trifft den Präsidenten der Palästinensischen Behörde Mahmud Abbas (links) in Straßburg © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament
Ich möchte an eine Reihe von Rechtsetzungsvorhaben erinnern, bei deren Abwicklung die Rolle des EP deutlich wurde.
Zu ihnen gehörte die REACH-Richtlinie über chemische Substanzen (eines der technisch kompliziertesten Gesetzeswerke, die das Europäische Parlament je passiert haben), bei der die vom EP vorgebrachten Änderungsvorschläge den Grundsatz der Verantwortung der Industrie und dem Verbraucherschutz Rechnung trugen. Dabei konnte das schwierige Gleichgewicht zwischen dem Vorsorgeprinzip und den mit der Wettbewerbsfähigkeit verbundenen Erfordernissen hergestellt werden.
Das EP spielte auch eine entscheidende Rolle bei der Ablehnung der Richtlinie über Software-Patente (als das Parlament zum ersten Mal in seiner Geschichte einer Richtlinie im Verfahren der Mitbestimmung in zweiter Lesung seine Zustimmung verweigerte), der Richtlinie für Hafendienstleistungen, die von der Europäischen Kommission endgültig zurückgezogen wurde, vor allem aber der als „Bolkestein-Richtlinie“ bekannten Richtlinie über die Liberalisierung von Dienstleistungen, die den Mythos vom „polnischen Klempner“ begründete und nach ihrer Erörterung im Parlament maßgeblich geändert wurde.
Bei dieser Richtlinie übernahm das EP unausgesprochen die Rechtsetzungsinitiative, die den Verträgen zufolge der Kommission vorbehalten ist. Angesichts der Schwierigkeiten im Rat, die Richtlinie zu ändern, und der Unfähigkeit der Kommission, sie zurückzuziehen, wurde zugelassen, dass das EP die Aufgabe übernahm, in Anbetracht all der widersprüchlichen Interessen und des großen Durcheinanders, das der Text und seine Auslegungen ausgelöst hatten, nach einem Konsens zu suchen. Diese schwierige Aufgabe bewältigte das EP mit Überlegung und ging dabei einen Konflikt zwischen den neuen und einigen alten Mitgliedstaaten aus dem Weg.
Die Rechtsetzungsaufgabe macht insgesamt den Erfolg eines Parlaments aus, dem es gelingt, Einigungen über Gesetzesvorschläge der Kommission herbeizuführen, in denen vielleicht der nach der Erweiterung entstandenen neuen Situation nicht genügend Rechnung getragen wird und die im Rat festgefahren sind. Es erfüllt mich mit großer Genugtuung zu sehen, wie die konstruktive und wirkungsvolle neue Rolle des EP als EU-Institution anerkannt wird, das seine Arbeitsweise sehr verbessert und in diesen Jahren an politischem Gewicht gewonnen hat.
Das EP wird heute vom Europäischen Rat in höherem Maße anerkannt. Bei jedem seiner Treffen hatte ich die Gelegenheit, mich im Namen des Parlaments an die Staats- und Regierungschefs der EU zu wenden, und konnte dabei feststellen, dass dem EP immer mehr Gehör geschenkt wurde und dass es inzwischen häufiger zu Beratungen eingeladen wird.
Auch der Schutz der demokratischen Werte und der Menschenrechte hat sich als Identitätsmerkmal des EP gefestigt. Das ist ein zentrales Thema in den Beziehungen zwischen dem EP und anderen Ländern. Daran habe ich – bisweilen unter schwierigen Voraussetzungen – bei all meinen offiziellen Besuchen erinnert. Das EP hat auch wichtige Initiativen ergriffen, etwa zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses zu den mutmaßlichen illegalen Aktivitäten der CIA in der EU. Dadurch wurde den Mitgliedstaaten in Erinnerung gerufen, wie wichtig es ist, an den demokratischen Werten, auf denen unsere Union beruht, festzuhalten.
Nach dieser Erfahrung glaube ich, dass das Europäische Parlament als Symbol der repräsentativen Demokratie in Europa und als Keimzelle einer supranationalen Demokratie seine Arbeit weiter verbessern muss, um zur erneuten Lancierung des europäischen Projekts beizutragen. Dieses Projekt lässt sich nicht ohne die Bürger, d. h. nicht ohne eine stärkere Einbeziehung der nationalen Parlamente, und nicht ohne eine stärkere Rolle des EP gestalten.
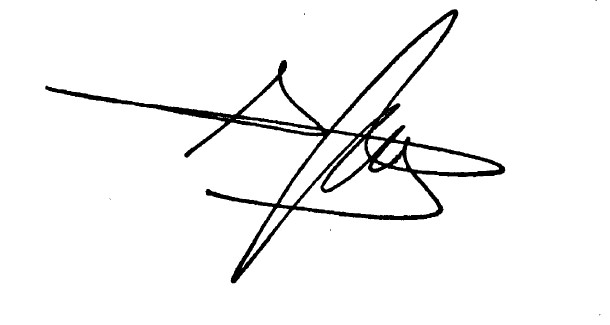
 Wahl des EP-Präsidenten Josep Borrell Fontelles während der Plenarsitzung in Straßburg © Europäische Union 2004 – Europäisches Parlament
Wahl des EP-Präsidenten Josep Borrell Fontelles während der Plenarsitzung in Straßburg © Europäische Union 2004 – Europäisches Parlament
 Gruppenfoto der neuen bulgarischen und rumänischen Beobachter © Europäische Union 2005 – Europäisches Parlament
Gruppenfoto der neuen bulgarischen und rumänischen Beobachter © Europäische Union 2005 – Europäisches Parlament
 Plenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum (Euromed). Abgebildet (von links nach rechts): Dietmar Nickel, Josep Borrell Fontelles, Fouad Mebazaa © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament
Plenarsitzung der Parlamentarischen Versammlung der Union für den Mittelmeerraum (Euromed). Abgebildet (von links nach rechts): Dietmar Nickel, Josep Borrell Fontelles, Fouad Mebazaa © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament
 EP-Präsident Josep Borrell Fontelles (rechts) trifft den Präsidenten der Palästinensischen Behörde Mahmud Abbas (links) in Straßburg © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament
EP-Präsident Josep Borrell Fontelles (rechts) trifft den Präsidenten der Palästinensischen Behörde Mahmud Abbas (links) in Straßburg © Europäische Union 2006 – Europäisches Parlament